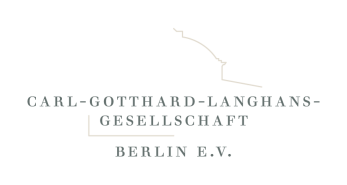Laudatio
zur Einweihung der Gedenktafel für Carl Gotthard Langhans am 1. Oktober 2018
Autorin: Dr. Zitha-Pöthe Elevi, Berlin
Carl Gotthard Langhans kam am 15. Dezember 1732 in Schlesien, Landeshut zur Welt. Er starb am 1. Oktober 1808 in Grüneiche bei Breslau.
Im Jahr 1786 ist Carl Gotthard Langhans 54 Jahre alt und steht im Zenit seiner beruflichen Laufbahn. Er bekleidet ein Staatsamt, genießt Anerkennung, er lebt im eleganten Zentrum einer pulsierenden Hauptstadt Preußens – Breslau –, das Friedrich II. als die „Perle in der Krone“ bezeichnet hatte. Langhans kann mehr als zufrieden sein.
Doch zwei Jahre später zieht er weg. Noch dazu in das Schlusslicht der preußischen Hauptstädte, nach Berlin. Umzug bedeutet: Haus verkaufen, eine temporäre Bleibe suchen, neue berufliche Herausforderungen, ein eigenes Haus planen und, während der ganzen Zeit, hüben wie drüben für den neuen Arbeitgeber Gewehr bei Fuß stehen.
Welches Motiv war so gewichtig, diese Anstrengung auf sich zu nehmen? War ihm der Ruf des Königs so viel wert? Das allein kann es nicht gewesen sein. Jahre zuvor war Langhans einer Einladung Friedrichs II. nach Berlin zu kommen, noch nicht gefolgt. Erst sein Nachfolger, Friedrich Wilhelm II. eröffnete Langhans die einmalige Aussicht auf berufliche Weiterentwicklung.
In Berlin stand die erste große Neuordnung des Königlich Preußischen Bauwesens an. Dazu gehörte der Aufbau des Oberhofbauamts, dem Langhans seit 1788 als Direktor vorstand. Nicht mehr der einzelne königliche Baurat plante hier im stillen Kämmerlein vor sich hin. Erstmals besprach sich ein Kollegium, das seine Einsichten, Talente und Erfahrungen versammelte. Von hier aus wurden sämtliche königlichen Bauleistungen für Berlin, Potsdam und Charlottenburg geplant und gesteuert.
Für Langhans war die Arbeit in dieser Behörde ein großer Vorteil, weil er hier endlich zwei seiner wichtigsten Tätigkeitsfelder zusammenführte: Die Arbeit als staatlicher Baurat für öffentliche Bauaufgaben wie Brücken, Kasernen, Armenhäuser, die der Funktionalität und Sparsamkeit unterworfen waren, und seine Tätigkeit als freier Architekt, der repräsentative Prachtbauten plante, die den höchsten geschmacklichen Ansprüchen entsprachen.
Rokoko, Barock, Klassizismus – Kirchen, Theater, Paläste, Fassaden, Innenräume, Möbel – Langhans bediente das gesamte Spektrum an Bauaufgaben.
Dieser ungewöhnlich vielseitige Erfahrungsschatz gewährte ihm, dem Sohn des Schweidnitzer Gymnasialdirektors, Einlass in den engsten Kreis des Königs. Der setzte persönlich Langhansʼ Bestallungsurkunde auf. Hierin wurde Langhans eine seltene Gunst zuteil. Es heißt in der Akte, Langhans solle „Rat und Gutachten, nach bestem Wissen und Gewissen aufs getreulichste eröffnen“, also: Offen mit dem König sprechen, eine Aufforderung, die in vergleichbaren Arbeitsverträgen so nicht vorkommt.
Langhansʼ gesellschaftlicher Aufstieg folgte dem Weg eines, wie wir heute sagen würden: „Self-Made Man“. Ein Begriff, der bereits zu Langhans‘ Zeiten in Amerika geprägt wurde. Er bezeichnet jemanden, der aus vergleichsweise bescheidenen Verhältnissen stammt, und der die niedrige soziale Stellung der Eltern überwindet, indem er sich selbst neu erfindet und hart an sich arbeitet.
Genau das trifft auf Langhans zu. Mit Anfang zwanzig ging er nach Halle, um dort zunächst Rechtswissenschaften zu studieren.
Als Langhans dann aber nach vier Jahren Universitätsleben nach Schlesien heimkehrte, begann der Siebenjährige Krieg (1757), vielleicht war dies auch der Grund seiner Rückkehr. Und Langhans traf eine
pragmatische Lebensentscheidung. Er verließ den für ihn vorgesehenen Weg, wechselte die Branche und wurde – über einen kleinen Umweg als Privatlehrer – Baumeister. Denn, wie Heraklit schon wusste:
„Bellum omnium pater“: der Krieg ist der Vater aller Dinge.
Diese kamen zu Langhansʼ Zeit in Form von Gotteshäusern auf die Schlesier.
Das Bauwesen in Schlesien boomte! Die neue Glaubensfreiheit unter Friedrich dem Großen hatte zu einer Welle an Neubauten geführt, zunächst einfacher Bethäuser ohne Turm, später, nach dem dritten schlesischen Krieg, auch fester Kirchenbauten. Viele schlesische Bau- und Maurermeister arbeiteten für katholische wie evangelische Auftraggeber.
Langhans‘ Neuanfang muss mit einer handwerklichen Ausbildung verbunden gewesen sein, womöglich in der preußischen Bauverwaltung.
Er arbeitete sich hoch und machte sich recht schnell einen Namen: In Breslau, dem Hauptquartier Friedrichs II., traf Langhans auf hohe Staatsbeamte und schlesische Adlige, die er mit seiner Arbeit überzeugen konnte. Er lieferte 1764 bspw. schon Pläne für ein Herrschaftshaus. Er entwarf Grundriss und Innenraumgestaltung eines neuen Flügels für das Trachenberger Palais des Grafen Hatzfeld.
Von diesem Kunden, dem Grafen Hatzfeld, für den er lange arbeiten sollte, erhielt er den Auftrag, in Italien Marmor zu kaufen – und die Chance, klassische Baukunst zu studieren.
1768: Langhans reiste über Wien, wo er die kaiserlichen Paläste betrat, nach Bologna, wo er die unverputzten Ziegelbauten bewunderte. Er sah die Steinbrüche von Carrara und stand auf der Piazza San
Marco in Venedig. Weiter ging es nach Rom, das er im Sommer 1769 erreichte. Von dort reiste er nach Neapel.
Langhans’ Reisetagebücher und Zeichenmappen sind der Nachwelt nicht, oder nur bruchstückhaft erhalten. So ist zwar aus der Literatur bekannt, dass die noch heiße Lava des Vesuvs unseren Baumeister beeindruckte, aber nicht mehr, wie er die Besuche der nahegelegenen Ausgrabungsstätten Herculaneum und Pompeji empfand. Dass Langhans aber von griechischer Architektur fasziniert war, zeigt seine spätere Arbeit.
Aus Italien brachte Langhans ein vergrößertes Repertoire an griechischen Formen für die Fassadengestaltung mit: Für den preußischen Minister in Schlesien bekleidete Langhans die Fassade des Schlosses in Dyhernfurth mit einem „attischen Kostüm“, einer klassizistischen, an Tempelbauten Mittelgriechenlands erinnernde Bauordnung.
Doch trotz seiner Bewunderung für antike Formen schaute Langhans sehr genau hinter die Fassaden der Architekturen und entwickelte eine eigene, sehr durchdachte Position gegenüber antiker Baukunst. Er stimmte nicht in den Kanon der Lobhudeleien ein, der den Reisejournalen des 18. Jahrhunderts eigen ist, sondern entlarvte die antike Baukunst – wie den Circus Maximus in Rom – als rückständig. Vom Fortschritt überholt.
1775, mit Anfang 40, trat Carl Gotthard Langhans in den Staatsdienst ein. Als königlicher Oberbaurat Friedrichs II. verantwortete er sämtliche staatlich finanzierte Straßen-, Brücken-, Wasser- und Nutzbauten in 15 schlesischen Landkreisen. Er unterhielt später auch eine eigene Baumittelfabrik: eine Kalkbrennerei.
Im selben Jahr trat Langhans eine weitere Reise an. Im Auftrag des Königs studierte er die wichtigsten Kanal-, Häfen,- und Fabrikarchitekturen in den Niederlanden und Großbritannien.
Auf dem Weg nach London traf Langhans viele alte und neue Bekannte, deren Namen sich wie Einträge im Personenlexikon des achtzehnten Jahrhunderts lesen.
Er traf z. B. in Berlin auf Johann Sulzer, den Ästhetiker und Philosophen der Aufklärung. Sulzer war es, der der Ästhetik der Antike die berühmte „edle Einfalt und Größe“ zuschrieb.
Zwei Qualitäten, die Langhans ebenfalls mit seinen Entwürfen zu erreichen suchte.
Langhans‘ Reisen kennzeichnen eine Veränderung der Grand Tour, der klassischen Bildungsreise, die dem Adel vom 14. bis ins 18. Jh. vorbehalten war. Baumeister brachen zu technologischen Reisen auf und kamen mit wertvollem Wissen über neueste Fortschritte auf den Gebieten der Baukunst- und -technik nach Hause.
Langhans waren diese zwei Perspektiven ins Blut übergegangen: Die Sicht des staatlichen Baurats und die des Freiberuflers.
Für die preußische Baubehörde besah er Berg- und Hüttenwerke, Fabriken und Wasserbauten, Armen-, Schul-, und Krankenhäuser. Nach seiner Rückkehr entwarf er staatliche Bauten, die, wie Friedrich II.
es wünschte, weiterhin dem Barock verpflichtet waren. Sparsamkeit und Funktionalität standen bei den Arbeiten für die Baubehörde im Vordergrund.
Die großen englischen Landhäuser mit Gartenanlagen, in denen Teehäuser an verschlungenen Pfaden standen und künstliche Bäche aus Grotten plätscherten, betrachtete Langhans mit dem Blick des
Freiberuflers, mit dem er auch die Ästhetik der englischen Theater- und Kirchenbauten erfasste.
Er entdeckte den englischen Klassizismus, den er nach seiner Rückkehr in Schlesien anwandte, und die Neogotik, ein Stil, dem er erstmals beim Bau des Turmaufsatzes der Marientkirche 1787 in Berlin
nachgehen konnte.
Sein auf der Reise gesammeltes Stilrepertoire wandte er bis 1786 hauptsächlich für seine privaten Auftraggeber an. In Romberg bei Breslau legte er bspw. eine ideale Villa suburbana an. Wie der antike Autor Vitruv beschreibt, steht sie auf einer künstlichen Anhöhe an einem schmalen Flusslauf (wie auch das Tieranatomische Theater). Dem Eingang gab Langhans das Aussehen einer typischen palladianischen Serliana (= Palladio-Motiv).
Langhans zitierte damit nicht nur den in England favorisierten Palladianismus, er gab der Serliana, die in England zu einem Fenstermotiv herab gesunken war, ihren Platz als Hauptmotiv des Hauses zurück.
Die Villa in Romberg entsprach den modernsten Ansprüchen europäischer Architektur.
1782 wendete sich die Bürgerschaft Breslaus an den bedeutendsten in Schlesien lebenden Baumeister, den breitest aufgestellten Stilkenner. Auf seinen Reisen hatte Langhans auch fürstliche Theater- und Opernhäuser in ganz Europa studiert. Für Breslau plante er nun eines der ersten öffentlichen Theatergebäude, das Komödienhaus Zur kalten Asche.
Den Theatersaal plante Langhans elliptisch. Er hatte herausgefunden, dass die Ellipse den Schall harmonisch verteilt. Dazu bot die Form einen optimalen Blick auf die Bühne.
Langhans erkannte und nutzte akustische und optische Gesetze, die dem Inneren des Theaters Gestalt gaben. Er beschrieb einmal den Vorteil seiner Raumlösung gegenüber den zirkelförmigen Theatern der
Antike, in denen der Schall nicht das gesamte Auditorium erreichen konnte. Für Theater hatte Langhans eine eigene, fortschrittliche und optimale Raumlösung gefunden.
Das neue Theater in Breslau begründete Langhans‘ Ruf als Theaterarchitekt. Seine Begeisterung für den Theaterbau, Schallwellen und Bühnentechnik gab er übrigens an seinen Sohn, Carl Ferdinand Langhans weiter.
Langhans der Jüngere sollte nach dem Tod seines Vaters zwei Spielhäuser ersetzen, an denen sein Vater geplant hatte: Das Theater Zur kalten Asche in Breslau und das Berliner Opernhaus unter den
Linden, Carl Gotthard Langhans‘ erstes Projekt in Berlin.
König Friedrich Wilhelm II. lud Langhans 1787 nämlich zunächst nach Berlin ein, um ihn beim Umbau der Oper Unter den Linden zu beraten. Langhans Pläne erhielten den Beifall des Königs, der ihn gleich mit einem neuen Projekt an sich band.
Das Schloss Charlottenburg sollte westlich mit einem Theaterbau erweitert werden. Als es 1790 fertig war, galt es aufgrund seiner Bühneneinrichtung als Juwel unter den Schaustätten.
Auch das Lusthäuschen im Schlosspark, das Belvedere stammt aus Langhans Feder. Folgen Sie dort unbedingt einmal dem Lauf des Treppengeländers: Es liegt in der Hand wie ein Handschmeichler. Und es ist
das einzig originale Detail der Bausubstanz. Den Rest hat der Zweite Weltkrieg mit sich gerissen.
Im Schlosspark entstanden weiterhin zwei hölzerne Kleinarchitekturen. Ein „ota-haitisches“ und ein „gotisches“ Angelhaus. Für Langhans war das keine bloße Spielerei, sondern echte Grundlagenforschung. Er erfand hier eine 200 Jahre alte Bautechnik aus Frankreich völlig neu. Er experimentierte mit hölzernen Tragwerken und entwickelte eine eigene Form der Bohlenbindertechnik, eine Holz und Kosten sparende Bauweise. Kurze Zeit später verwendete er sie für die erste größere Bohlenbinderkuppel: für das Dach des Anatomischen Theaters der Tierarzneischule, - dem ältesten erhaltenen Lehrgebäude Berlins.
Sehr viel später sollte er das Dach des neuen königlichen Schauspielhauses auf dem Gendarmenmarkt als Bohlendach konstruieren. Die äußere Erscheinung traf allerdings auf die Kritik der Zeitgenossen, zu klobig, zu schwerfällig, sehe das Dach aus, hieß es, als „der Koffer“ wurde es verlacht.
Doch gab die Innere Notwendigkeit dem Bau seine Form: Langhans Dachstuhl war kein unzugänglicher Sparren-Urwald, sondern eine riesige Halle, die als Theatermalersaal konzipiert war.
Langhans unterwarf die Form der Funktion, und war damit seiner Zeit um Lichtjahre voraus – die Methode begegnet uns später wieder, im Motto der Bauhaus-Künstler: form follows function.
Für die Erforschung und Entwicklung der Bohlenbindertechnik ging Langhans sogar so weit, sein eigenes Haus, hier in der Charlottenstraße, als Experimentierfeld einzurichten. Er ließ ein pultförmiges Bohlenbinderdach zimmern - und beobachtete über Jahre das Langzeitverhalten der Sparren.
1787 errichtete er das Haus, hier an dieser Stelle, in direkter Nachbarschaft zum Gendarmenmarkt. Die erste Adresse desselben Hauses lautete Charlottenstraße 31, später bekam es dann die Nummer 48. Hier wohnte er gemeinsam mit seiner Frau Anna Elisabeth, einer angesehenen Künstlerin, und den Kindern Carl, (Louise) Amalie und Juliane (Wilhelmine). Abgerissen wurde das Haus irgendwann vor dem Jahr 1882. Leider konnten, trotz intensiver Recherche, keine Abbildungen gefunden werden.
Wir können uns dennoch eine Vorstellung von dem Gebäude machen: Das Feuerkatasterbuch Berlins aus dem Jahr 1836 beschreibt das Haus als ein unterkellertes dreigeschossiges Eckhaus. Die
repräsentative Hauptansicht zur Charlottenstraße zeigte einen Mittelrisalit.
Im Hof führten zwei überdachte Treppenaufgänge in das Innere des Hauses. Im Hof dürfen wir uns ein leises Plätschern ausmalen, das von einem Brunnen mit Becken herrührte. Auf dem Hof befanden sich
linkerhand die Versorgungsgebäude: Ein Stall mit Wohnhaus, eine Wagenremise und ein Waschhaus. Zwischen diesen Gebäuden befand sich wiederum ein schmaler Hof mit Appartements.
Über das Innere des Hauses ist lediglich der Inhalt eines Raumes bekannt. Langhans` Testament bietet einen kleinen Einblick in seine Bibliothek. Denn er vermachte alles, was sich darin befand, noch zu Lebzeiten seinem Sohn Carl Ferdinand. Die Regale bogen sich unter Büchern zu „Museumsliteratur, antiken Bausammlungen, Theaterbau und Maschinerie, antiken Kostüme, Astronomie, Brückenbau, Gartenbaukunst, Herculaneum, toskanische Baukunst, zivile Architektur, Architektur in England, Architektur in den Niederlanden, Ruinen von Athen, Ornamente“. Zeichnungen, Kupferstiche, Gemälde und mathematische Instrumente waren hier auch zu finden.
Sein Haus stand in direkter Nachbarschaft zu dem Bauwerk, für das er heute bekannt ist. Das Bauwerk, dem der noch sehr junge Bildhauer Johann Gottfried Schadow die unvergleichliche Quadriga aufsetzte: das Brandenburger Tor.
Allerdings sollte Langhans nicht für die Form in Erinnerung bleiben, die an die Propyläen der Athener Akropolis erinnert.
Die Idee zum Tor stammte von Friedrich Wilhelm II. und war politischer Natur.
Langhans Verdienst ist es, dass diese Idee überhaupt umgesetzt werden konnte – und heute noch steht.
Langhans bemühte sein ganzes Wissen über Materialeigenschaften und Können als Brückenbaumeister.
Der Baukörper ist eine raffinierte Kombination aus Renaissance-Bauweise und damals modernster Bautechnik: Ziegelmauerwerk, hängende Architrave, schmiedeeisernes Zugbandsystem, Eisenanker in Säulen
und Wänden, hölzerne Druckgurte: Das Brandenburger Tor ist Langhans‘ Meisterwerk vorindustrieller Ingenieursbaukunst.
Zwanzig Jahre lebte er in Berlin. Durch sein technologisches und künstlerisches Wissen setzte er mit dem Oberhofbauamt neue Maßstäbe. Die ersten Blitzableiter auf königlichen Bauwerken wurden installiert. Die Straßenpflasterung wurde begonnen. Das Oberhofbauamt förderte eine Reform der Energieversorgung. Auf den Holzmärkten errichtet es bereits 1788 Torf- und Steinkohlemagazine. Die Steinkohle kam aus Langhans Heimat Schlesien.
Als er Berlin verließ, war die Stadt bereit für den nächsten Schritt in Richtung Reichshauptstadt. Denn der Griff nach der Kaiserkrone war ein bereits 1788 gehegter Plan der Hohenzollern-Monarchie.
Mit Langhans‘ letztem Werk, eine 1802 von ihm geplante, protestantische Kirche in Rawitsch, schließt sich ein Kreis. Denn das Bauwerk, das ihm 1763 den Durchbruch verschafft hatte, sein Erstling, war ebenfalls eine Kirche gewesen (Glogau).
In Grüneiche bei Breslau starb Carl Gotthard Langhans, heute vor 210 Jahren, am 1. Oktober 1808 – nach einem langen erfüllten Leben, gesegnet, an Altersschwäche. Beigesetzt wurde er auf dem Großen Friedhof in Breslau. Das Grab, seinem Wunsch nach „ohne Pracht“ gestaltet, ist verloren.
Erhalten sind uns einige wenige Bauwerke. Sie liefern Zeugnis von Langhans lebenslangem Streben nach Fortschritt. In der ihm nachgesagten „Stilunsicherheit“ erkenne ich eher den Beweis seiner unschlagbaren Brillanz. Der Stil spielte in seinem Werk eine Rolle, aber nicht die Hauptrolle. Was ihn bewegte, war die Bauphysik, die im Inneren seiner Gebäude wirkte.
Als Ingenieur und Wissenschaftler wurde und wird Langhans von einem überschaubaren Kreis wahrgenommen. Langhans störte das offensichtlich nicht, sonst hätte er mehr über seine Projekte publiziert.
Doch er setzte Bauen vors Schreiben und die Wissenschaft noch an erste Stelle.
Es ist als hätte Friedrich Schiller in seinem Gedicht über den Genius jemanden wie Langhans vor seinem inneren Auge gesehen, als er schrieb: „Dich kann die Wissenschaft nichts lehren. Sie lerne von
dir!“
(Laudatio gehalten von Dr. Zitha Pöthe-Elevi
am 1. Oktober 2018
in der Charlottenstraße 48 in Berlin-Mitte)